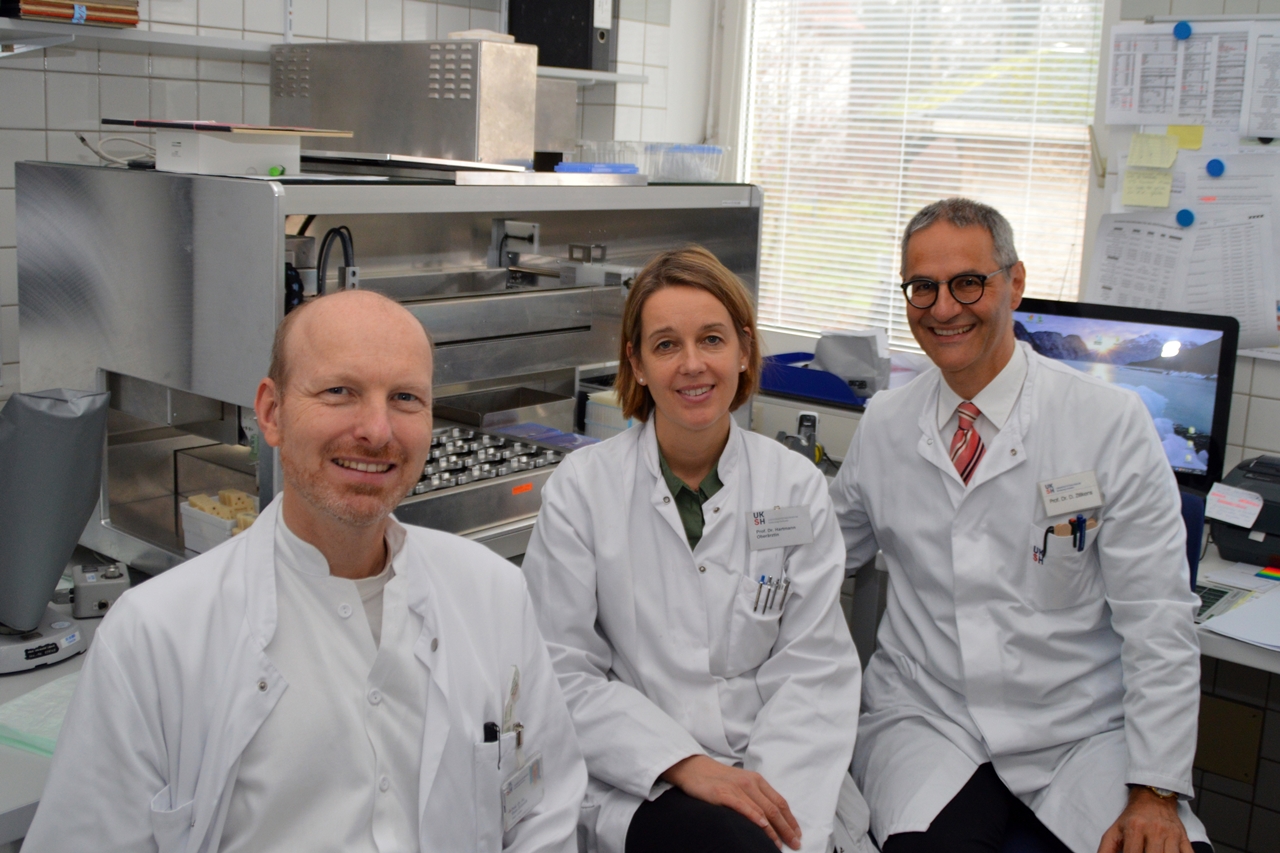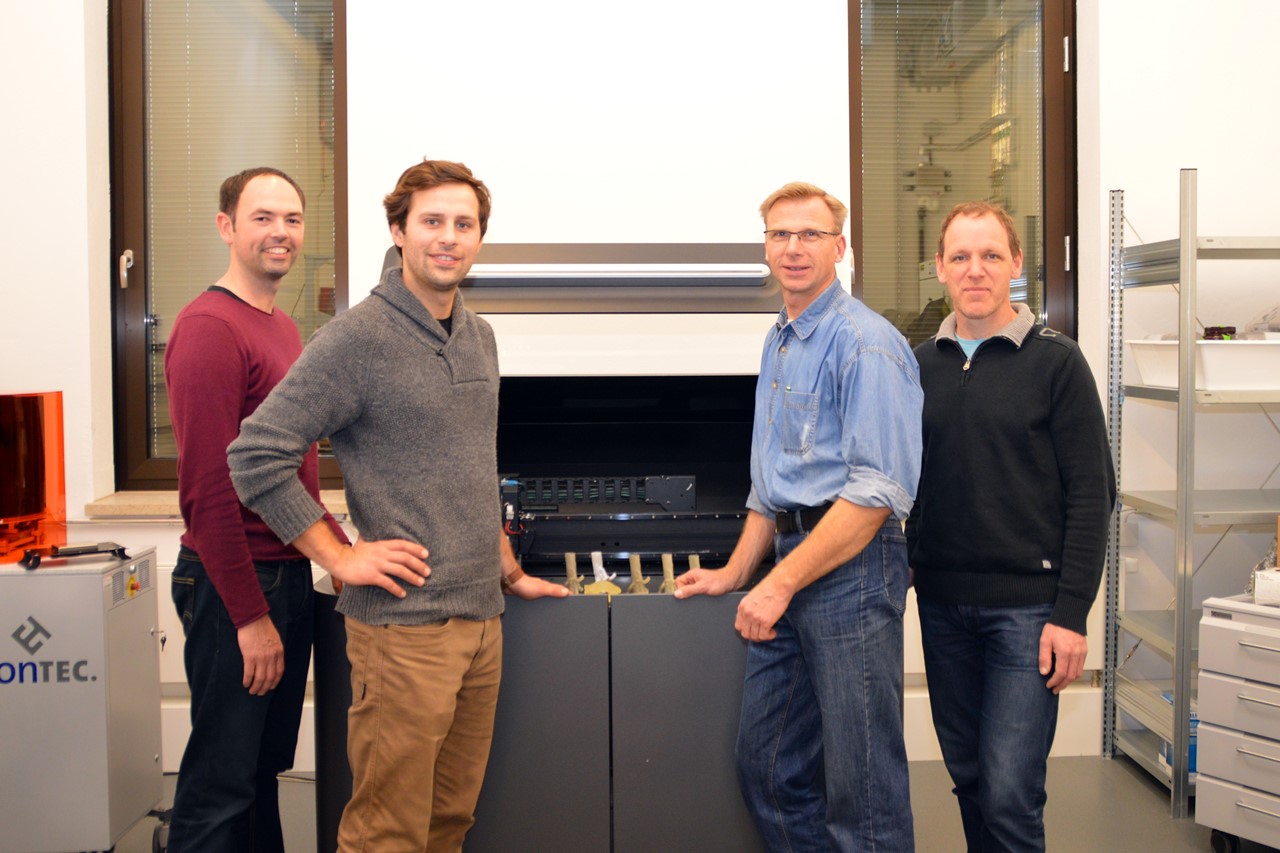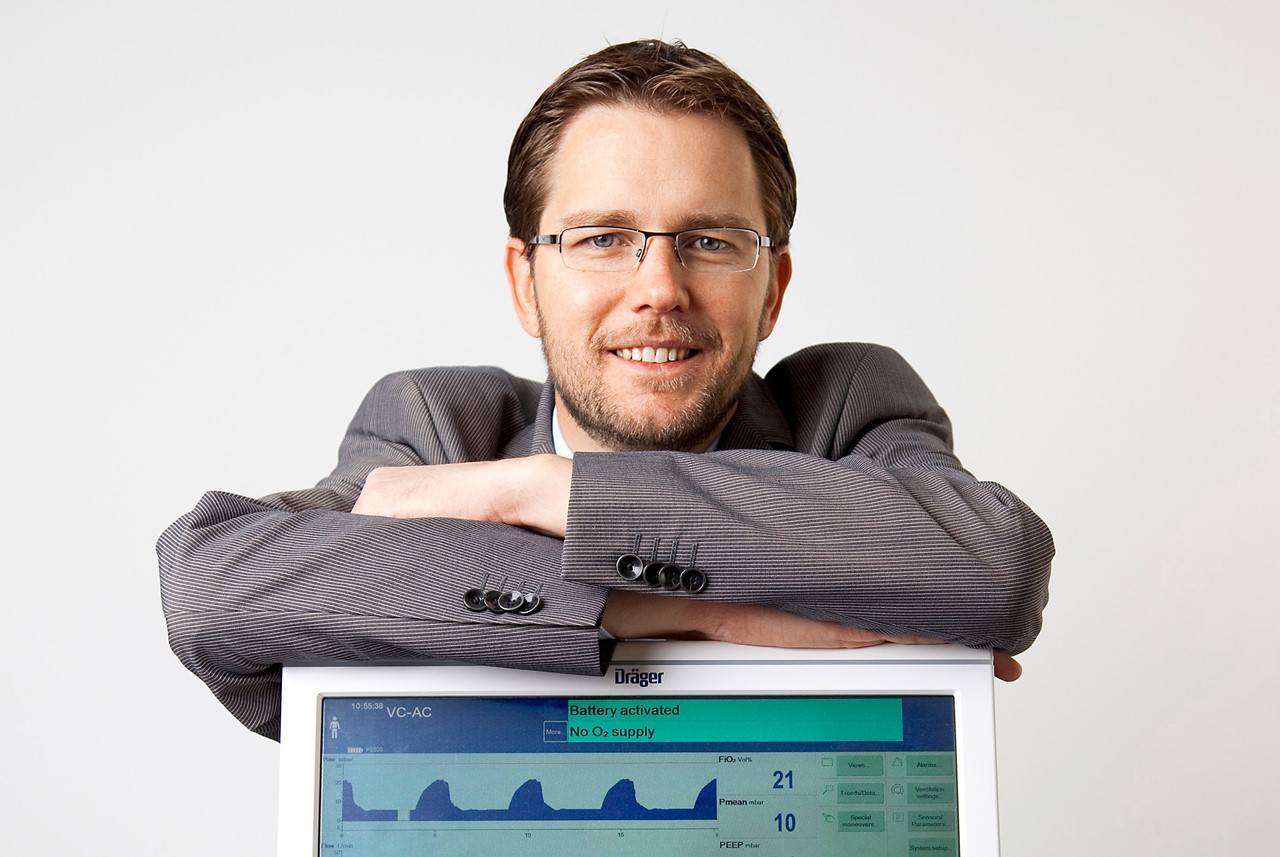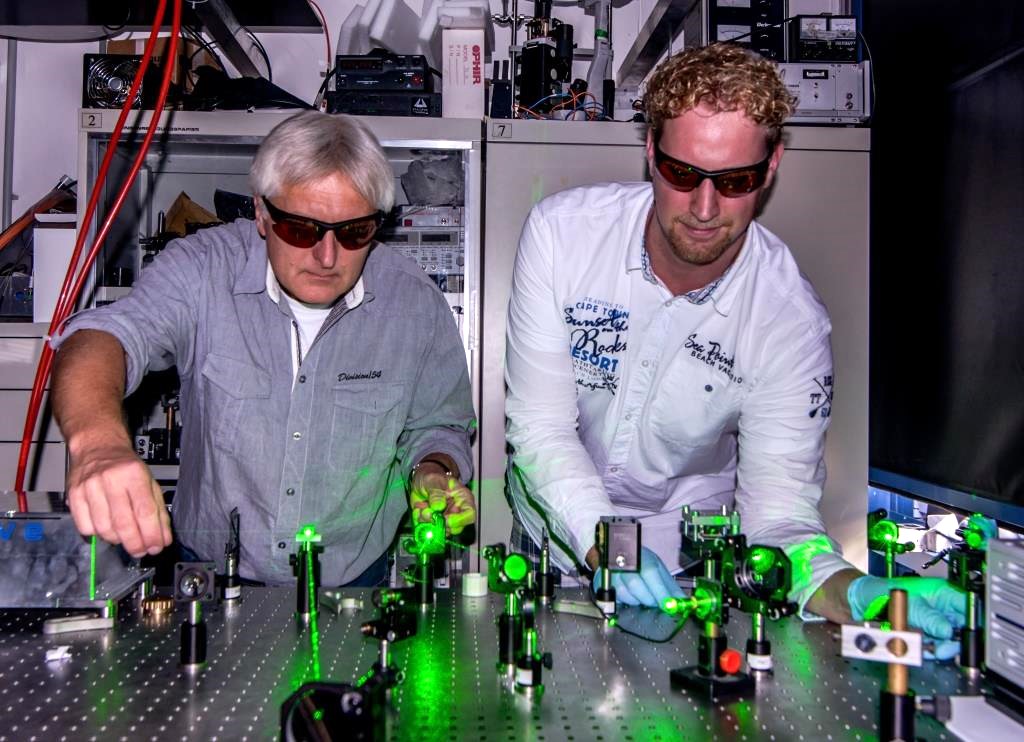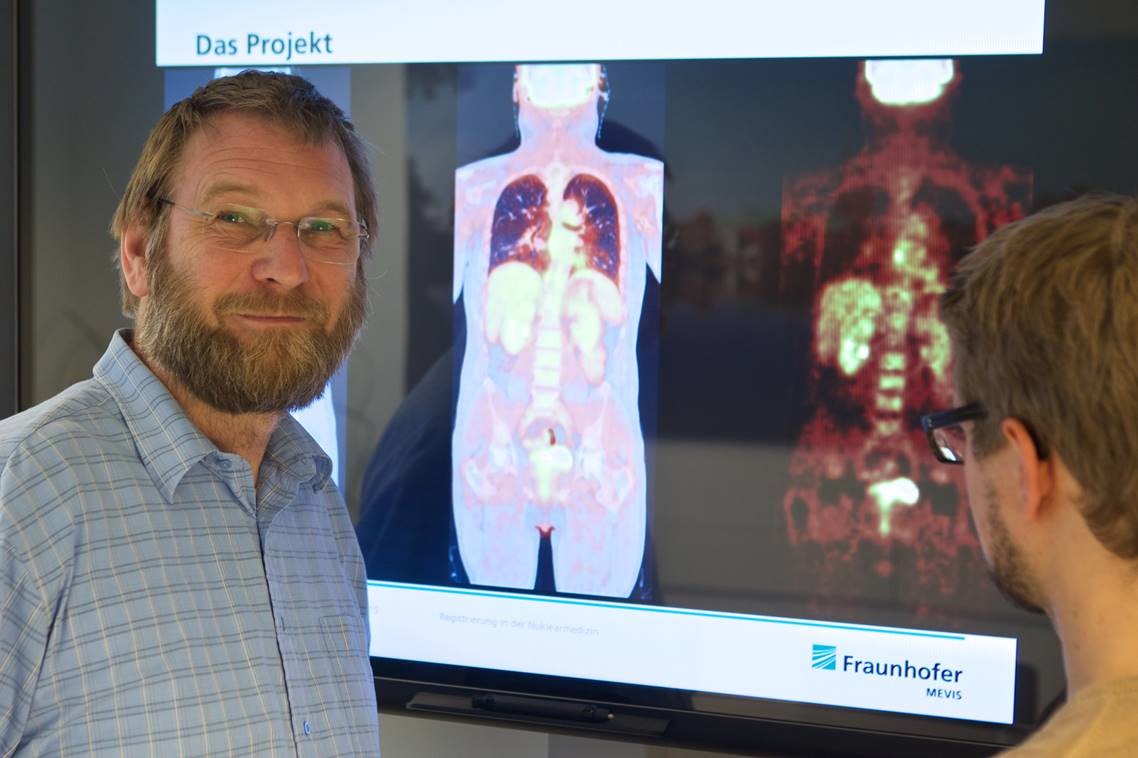Das menschliche Immunsystem arbeitet nicht immer problemlos. Manchmal wendet es sich gegen im eigenen Körper befindliche Stoffe und produziert unerwünschte entzündliche Prozesse in sogenannten „Autoimmunerkrankungen“. Noch viel häufiger reagiert das Immunsystem in überschießender Weise auf von außen kommende Reizstoffe, man spricht dann von Allergien. Die medizinische Forschung arbeitet an neuen Verfahren, die eine individuelle Diagnostik und Therapie solcher Erkrankungen ermöglichen. Die Lübecker Klinik für Dermatologie, Allergologie und Venerologie (kurz: Hautklinik) am UKSH entwickelt in Zusammenarbeit mit Medizinprodukte-Herstellern neue Nachweis- und Behandlungstechniken auf diesen Gebieten. Das Klinik-Team von Professor Dr. Detlef Zillikens beteiligt sich in diesem Themenfeld an der „Industrie-in-Klinik-Plattform Lübeck“.
Vor einem neuen Färbeautomaten im Labor: (v. r.) Prof. Detlef Zillikens, Prof. Karin Hartmann, Prof. Enno Schmidt
„Hautkrankheiten und Allergien beeinträchtigen die Lebensqualität unserer Patienten oft erheblich. Wir entwickeln deshalb ständig neue Verfahren für eine bessere Erkennung von spezifischen, das Krankheitsbild erzeugenden Antikörpern im Körper eines Patienten“, erklärt der Klinik-Leiter. Dabei setzt Zillikens auf eine enge Kooperation mit Herstellern von Laborgeräten und Labordiagnostika. „Von unserer Seite kommen gut charakterisierte Patienten-Daten und -Proben aus unserer wachsenden Biobank und später die Möglichkeit der umfassenden klinischen Validierung. Die Hersteller bringen die Expertise ein für die Produktion von geeigneten, sensitiven und spezifischen Nachweisstoffen und von neuen Geräten zur standardisierten, automatischen Bearbeitung von Gewebeproben und Seren“, erläutert Professor Dr. Dr. Enno Schmidt, Direktor des Lübecker Institut für Experimentelle Dermatologie.
Professor Dr. Karin Hartmann hat sich auf das Thema Allergien spezialisiert. „Allergien werden weltweit immer häufiger, aber die Menschen reagieren regional auf ganz unterschiedliche Allergene, sodass hier ein weites Forschungs- und Entwicklungsfeld vor uns liegt“, berichtet die Leiterin der Allergieabteilung der Hautklinik. Die Lübecker Experten arbeiten gegenwärtig unter anderem an der Testung und Validierung sogenannter „rekombinanter Allergene“ (also künstlich hergestellter allergener Eiweiße) für den Einsatz in einem in der Entwicklung befindlichen „Random-Access-Automaten“. Dieser Automat soll zukünftig die automatische Analyse von Antikörpern im Serum (des Patientenblutes) ermöglichen. Dabei kommt eine spezielle „Beads“-Technologie zum Einsatz: Mit den in bestimmter Weise beschichteten magnetischen Träger-„Kügelchen“ wird es möglich, Blut auf gleich mehrere Allergene gleichzeitig und unabhängig voneinander zu analysieren. „Das macht diese Technologie mit ständiger Zugriffsmöglichkeit nicht nur praktischer bei der täglichen Laborarbeit und präziser hinsichtlich der Ergebnisse, sondern auch schneller und wirtschaftlicher für das Labor“, betont Professor Schmidt.
Bei einer Gruppe von weniger verbreiteten Hautkrankheiten haben die Lübecker Hautärzte bereits mehrere neue Behandlungssysteme gefunden, die auch kommerziell erhältlich sind und erfolgreich eingesetzt werden. Bei den „bullösen“ (blasenbildenden) Autoimmundermatosen handelt es sich um eine Gruppe von Autoimmunkrankheiten, die Professor Zillikens als „Rheuma an der Haut“ beschreibt. „Wir konnten hier in den letzten Jahren nicht nur Nachweise von diversen auslösenden Autoantikörpern im Hautgewebe beziehungsweise im Blutserum der Patienten finden, sondern für einige dieser Autoantikörper auch Adsorber- oder Reinigungsverfahren entwickeln, die diese schädlichen Autoantikörper wirksam aus dem Blut entfernen “, so der Klinikchef. Weitere spezifisch wirksame Adsorbersysteme seien in der Entwicklung. In diesem Zusammenhang validieren Professor Zillikens und sein Team für einen Hersteller gegenwärtig auch einen neuen Färbeautomaten für Gewebeschnitte (Bild), der die Laborarbeit weiter beschleunigen und optimieren soll.
(rwe)